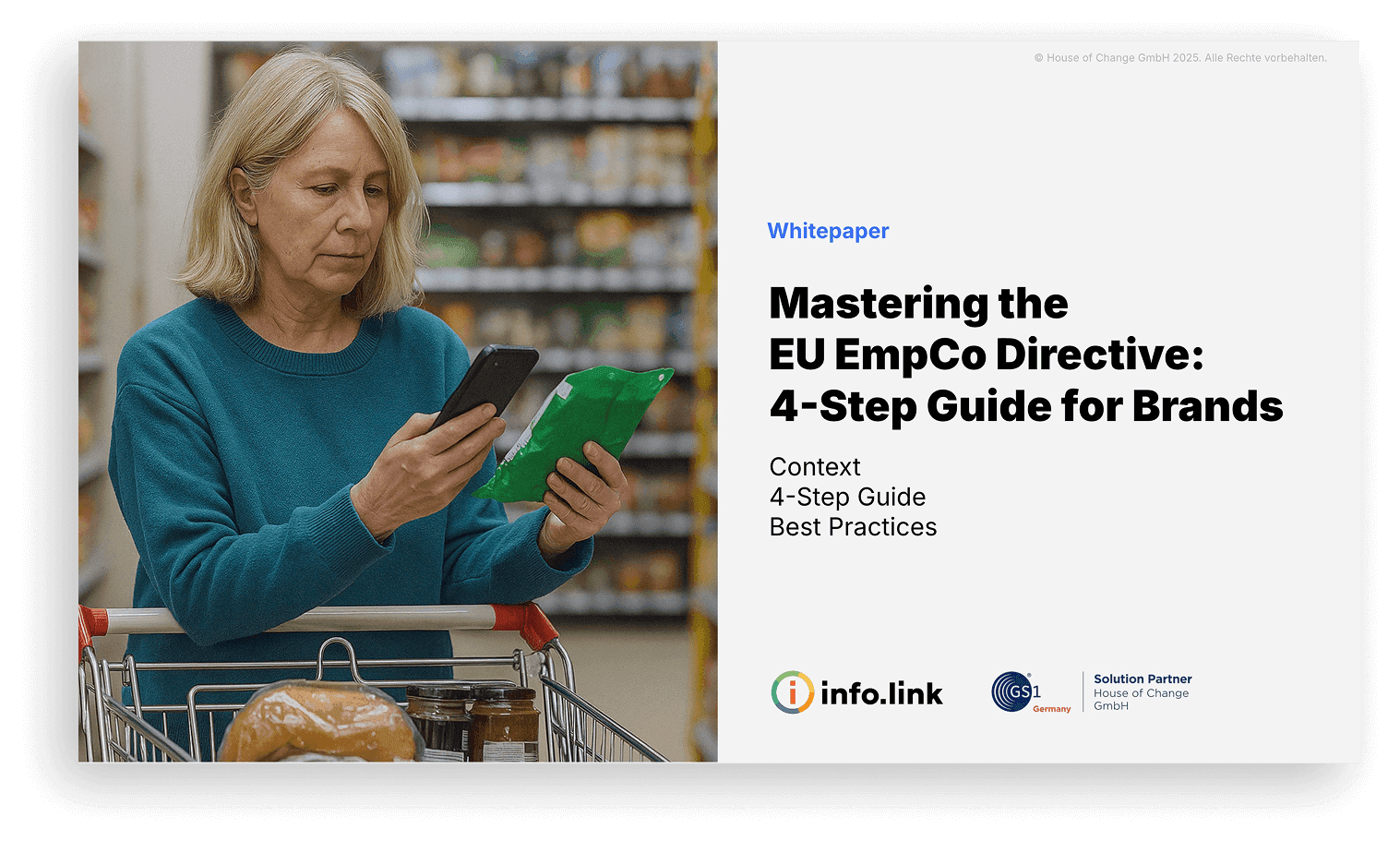EU Detergenzien-Verordnung & CLP: Compliance-Updates 2025
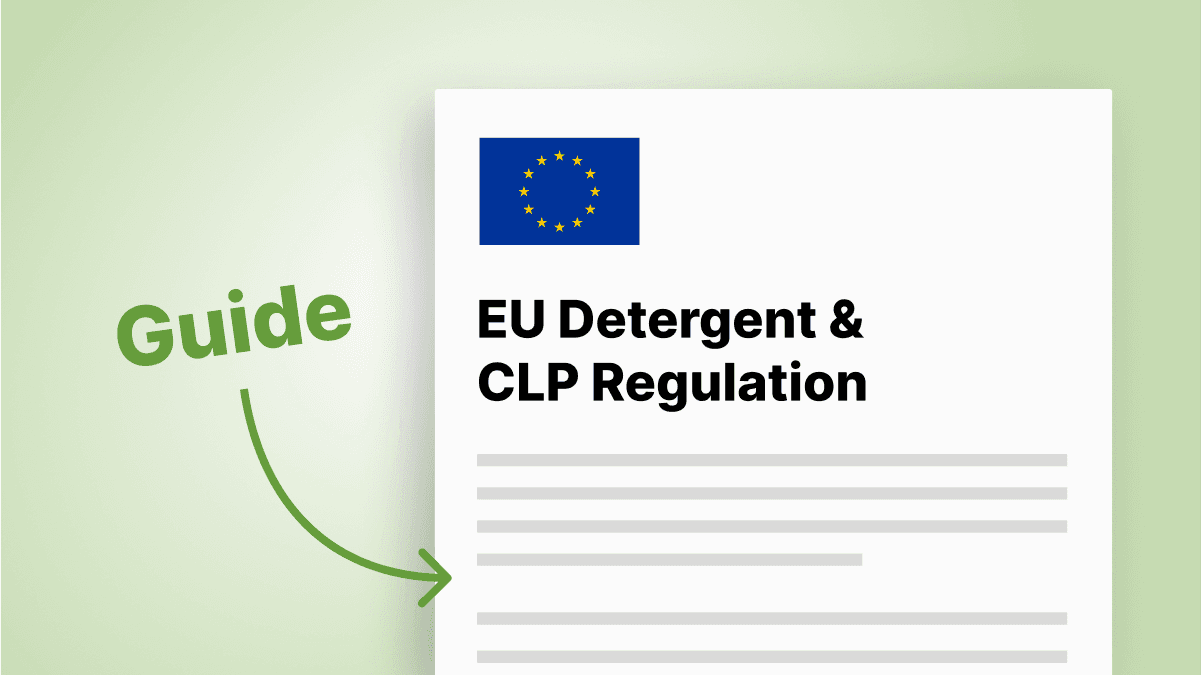
Die Europäische Union bringt ein umfassendes Update für die Regeln rund um Detergents auf den Weg. Die „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on detergents and surfactants“, veröffentlicht als COM(2023) 217 final, soll die bisherige Regulation (EC) No 648/2004 modernisieren und langfristig ersetzen. Detergents und Tenside sollen sich frei auf dem EU-Markt bewegen können, bei höchstem Schutz für Mensch und Umwelt.
Das neue Regelwerk greift zentrale Herausforderungen der alten Verordnung auf, vor allem wenn es um Innovation und Informationspflichten geht. Eine Überprüfung aus dem Jahr 2019 zeigte Probleme wie doppelte Vorschriften durch Überschneidungen mit anderen Chemikaliengesetzen, etwa der Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation.
Die alte Verordnung war zudem nicht ausreichend für innovative Produkte wie mikrobielle Reinigungsmittel oder nachhaltige Lösungen wie Nachfüllsysteme. Und: Ohne digitale Unterstützung wurden Labels oft „überfrachtet mit unklaren und sich wiederholenden Texten“.
Die neue Regulierung setzt deshalb auf einfache rechtliche Vorgaben und digitale Lösungen. Im Mittelpunkt stehen digitale Labels und ein Product Passport System. Das bedeutet:
- Mehr Transparenz: Informationen werden verständlicher; für Verbraucher:innen und Marktüberwachung gleichermaßen.
- Klare Vorgaben: Für Detergents mit Mikroorganismen werden erstmals spezifische Regeln eingeführt.
- Konsequenter Umweltschutz: Strenge Vorgaben zur biologischen Abbaubarkeit von Tensiden und klare Grenzwerte für Phosphate und andere Phosphorverbindungen schützen unsere Gewässer.
Zusätzlich wurde im Dezember 2024 die Verordnung (EU) 2024/2865 verabschiedet, die das CLP-Regelwerk modernisiert. Sie erlaubt erstmals digitale Etiketten und ausklappbare Label-Formate für chemische Produkte und schafft klare Fristen und Formatvorgaben. Auch wenn sie nicht speziell für Detergenzien entwickelt wurde, bereitet sie den Boden für die digitale Kommunikation chemischer Produktinformationen.
Detergents Regulation (EC No 648/2004) vs CLP Regulation (EC No 1272/2008)
Die CLP Regulation lässt sich als allgemeine Bibliothekarin verstehen: Sie bestimmt, wie jedes „Buch“ (Chemikalienprodukt) grundsätzlich sortiert und zugänglich gemacht wird; auch in digitaler Form. Die Detergents Regulation übernimmt die Rolle der Fachbibliothekarin für einen bestimmten Bereich (Detergents), setzt die allgemeinen Regeln um und ergänzt sie um Spezialfunktionen wie den „Product Passport“. So ist auch beim Nachfüllen oder bei rein digitalen Informationen sichergestellt, dass alles schnell, verständlich und sicher auffindbar bleibt, wie in einem gut sortierten, benutzerfreundlichen Digitalkatalog.
Ein Überblick über die relevante Regulatorik:

Image: Own illustration by info.link; Note: Without guarantee, not legally binding
Warum Compliance zählt: Risiken vermeiden. Vorsprung sichern.
Die neue Detergent Verordnung gilt, wie ihr Vorgänger, in allen EU-Mitgliedsstaaten verbindlich. Die Einhaltung der neuen Detergent Regulation ist jedoch mehr als Pflicht; sie bietet strategische Vorteile.
Wer nicht mitzieht, riskiert viel
- Kein Marktzugang: Produkte können am EU-Grenzübertritt scheitern.
- Finanzielle Sanktionen: Es drohen hohe Geldstrafen.
- Produktrückrufe: Artikel müssen womöglich zurückgerufen werden; teuer und imageschädigend.
- Vertrauensverlust: Die Markenreputation kann dauerhaft leiden.
Besonders entscheidend: Der neue Digital Product Passport (DPP) wird zum digitalen Türsteher. Produkte, die nicht regelkonform sind, werden systematisch vom EU-Markt ausgeschlossen.

Wer vorausdenkt, ist im Vorteil
Wer frühzeitig handelt und aktiv auf die neue Regulierung setzt, profitiert gleich mehrfach:
- Stabiler Marktzugang: Reinigungsmittel bleiben EU-weit uneingeschränkt erhältlich.
- Mehr Vertrauen: Transparente, digitale Produktinfos stärken die Entscheidungskompetenz der Verbraucher:innen und die Bindung zur Marke.
- Klarer Wettbewerbsvorteil: Organisationen, die schnell reagieren und Verantwortung zeigen, setzen sich sichtbar ab.
- Effizientere Abläufe: Digitale Labels und Produktpässe reduzieren Aufwand, automatisieren Compliance und beschleunigen Prozesse.
- Nachhaltigkeit als Standard: Refill-Konzepte und sichere, umweltfreundliche Formulierungen stärken nicht nur die Umweltbilanz; sie machen das Unternehmen fit für eine grünere Zukunft.
Was sich ändert: Was Marken für Reinigungsmittel jetzt wissen müssen
Die neue EU Detergent Regulation bringt umfassende Neuerungen mit sich – und Reinigungsmittelhersteller stehen vor der Aufgabe, diese in ihre Abläufe zu integrieren. Ziel der Änderungen: mehr Transparenz, einfachere Compliance und klare Antworten auf die Anforderungen eines modernen Marktes.
Der Digital Product Passport (DPP)
Im Zentrum der neuen Vorgaben steht der Digital Product Passport (DPP).
- Digitale ID für jedes Produkt: Jeder in der EU verkaufte Reiniger oder Tensid benötigt künftig einen eigenen digitalen Produktpass.
- Alle relevanten Infos an einem Ort: Der Pass enthält sämtliche compliance-relevanten Angaben.
- Zugänglich für Behörden und Nutzer:innen: Zoll, Marktüberwachung und Endverbraucher:innen erhalten direkten Zugriff auf diese Informationen.
- Digitale Zugangskontrolle: Der DPP wird zur zentralen Prüfinstanz für den Marktzugang – und macht Kontrollen effizienter als je zuvor.
Digital Labeling im Fokus
Neben dem DPP rückt auch das Thema Digital Labeling stark in den Vordergrund.
- Wichtige Infos bleiben vor Ort: Sicherheitshinweise und Anwendungsempfehlungen bleiben auf dem physischen Etikett verpflichtend.
- Mehr Details online: Ergänzende Informationen können digital bereitgestellt werden.
- Perfekt für neue Verkaufskonzepte: Besonders bei Refill-Modellen kann ein Großteil der Kennzeichnung digital erfolgen.
- Mehr Klarheit, weniger Etikettenchaos: Überfrachtete Labels gehören der Vergangenheit an; stattdessen gibt es aktuelle, gut zugängliche Informationen.
Die Grafik zeigt Ergebnisse einer Stakeholder-Umfrage zur Kennzeichnung von Waschmitteln in der EU. Dargestellt sind die Antworten auf die Frage „Inwieweit könnten Ihrer Meinung nach die folgenden Informationen vom Etikett auf der Verpackung eines Waschmittels entfernt und auf ein digitales Etikett übertragen werden?“.
Deutlich wird: Der Großteil ist der Meinung, dass Produktname und sicherheitsrelevante Angaben auf der Verpackung bleiben sollten, während z. B. Zutaten und Herstellerangaben aus Sicht vieler digital verfügbar sein können. Eine Hybridlösung aus Basisinfos auf der Packung und Details online wird häufig von vielen Stakeholdern bevorzugt.
Mehr Umweltschutz. Mehr Verantwortung.
Die Regulation stärkt auch die Vorgaben zu Biodegradability und Umweltverträglichkeit.
- Strenge Anforderungen bleiben: Tenside müssen weiterhin hohen biologischen Abbaubarkeitsstandards genügen.
- Grenzwerte für Phosphorverbindungen: Der Einsatz von Phosphaten und ähnlichen Stoffen wird klar begrenzt – zum Schutz von Gewässern und Ökosystemen.
Weniger Bürokratie. Mehr Effizienz.
Nicht zuletzt werden Informationspflichten gestrafft – etwa durch die Abschaffung des Inhaltsstoffdatenblatts für gefährliche Reinigungsmittel. Das reduziert den Verwaltungsaufwand deutlich und schafft ein klareres, effizienteres Regulierungssystem.
Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette
Die aktualisierte EU Detergent Regulation definiert klar, wer in der Lieferkette wofür zuständig ist – und erweitert in einigen Fällen auch bestehende Pflichten. Hersteller, Importeure und Händler tragen gemeinsam dazu bei, dass Reinigungsmittel sicher und konform auf den Markt kommen – vom ersten Entwicklungsschritt bis hin zum Endkunden.
Hersteller: Verantwortung von Anfang an
Hersteller tragen die Hauptverantwortung dafür, dass ihre Detergents und Tenside alle neuen Anforderungen erfüllen.
- Produktsicherheit und Konformität: Einschließlich Bewertung von Sicherheit und Konformität – besonders bei neuen Produktarten wie solchen mit Mikroorganismen.
- Technische Dokumentation: Alle relevanten Unterlagen (Zusammensetzung, Prüfberichte, Nachweise) müssen für mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden.
- Digital Product Passport (DPP):
- Pflicht für neue Produkte: Ab 30 Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung ist der DPP für alle neu auf den Markt gebrachten Detergents und Tenside verpflichtend.
- Übergangsfristen: Produkte, die davor auf dem Markt sind, oder kurz nach Einführung noch unter alten Regeln eingeführt werden, erhalten Übergangsfristen.
- Technische Anforderungen: Der DPP muss maschinenlesbar, strukturiert und durchsuchbar sein – auf offenen Standards basieren und vollständig kompatibel mit anderen EU-Produktpässen (z. B. unter der Ecodesign for Sustainable Products Regulation).
- Datenträger mit Produktverlinkung: Alle Konformitätsinfos müssen über einen Datenträger (z. B. QR-Code) mit einer eindeutigen Produktkennung verknüpft sein (direkt am Produkt oder auf der Verpackung).
- Zentrales EU-Register: Jeder DPP muss zudem im zentralen EU-Register referenziert werden, das im Rahmen der Ecodesign-Regelung aufgebaut wird.

- Kontinuierliche Marktüberwachung:
- Stichprobenkontrollen durchführen
- Kundenfeedback und Beschwerden auswerten
- Bei Problemen sofort reagieren – inklusive Rückrufen oder Rücknahmen
- Nationale Behörden unverzüglich informieren
Importeure: Kontrolle vor Markteintritt
Importeure spielen eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass Produkte aus Drittländern bereits vor Markteinführung alle EU-Vorgaben erfüllen.
- Konformitätsprüfung: Dazu gehört die Kontrolle, ob der Hersteller alle Bewertungen vorgenommen hat, ob die CE-Kennzeichnung (sofern erforderlich) vorhanden ist und ob DPP sowie digitale Kennzeichnung verfügbar sind.
- Kennzeichnung und Dokumentation: Name und Kontaktdaten des Importeurs müssen auf dem Produkt vermerkt sein. Technische Unterlagen sind für 10 Jahre aufzubewahren.
- Marktüberwachung: Importeure müssen aktiv an der Überwachung mitwirken – inklusive Meldung von Vorfällen und Mitwirkung an Korrekturmaßnahmen.
Händler: Sorgfalt bei der Bereitstellung
Auch Händler tragen Verantwortung, wenn Produkte in den Verkehr gebracht werden.
- Überprüfungspflicht: Vor dem Verkauf muss geprüft werden, ob CE-Kennzeichnung sowie physische und digitale Etiketten korrekt vorhanden sind.
- Lagerung und Transport: Produkte dürfen durch Lager- oder Transportbedingungen nicht in ihrer Konformität beeinträchtigt werden.
- Meldung von Verstößen: Bei Verdacht auf Verstöße oder Gefahren müssen Hersteller (oder Importeure) und Marktüberwachungsbehörden umgehend informiert werden – inklusive aktiver Mitwirkung bei Rückrufen oder anderen Maßnahmen.
Gemeinsame Verantwortung in der Lieferkette
Alle Wirtschaftsakteure entlang der Wertschöpfungskette teilen sich zentrale Pflichten:
- Zusammenarbeit mit Behörden: Bei Kontrollen, Rückrufen oder Informationsanforderungen ist aktive Unterstützung Pflicht.
- Datenaufbewahrung: Alle relevanten Informationen müssen für mindestens 10 Jahre verfügbar gehalten werden, für mehr Rückverfolgbarkeit und Sicherheit.
Kennzeichnung im Überblick: Was gehört wohin?
Die neue EU Detergent Regulation verändert grundlegend, wie Inhaltsstoffe und Kennzeichnungsinformationen bei Reinigungsmitteln dargestellt werden müssen. Der Fokus liegt auf einem klareren, digital-first Ansatz, jedoch ohne auf wichtige Informationen auf der Verpackung zu verzichten.
Was weiterhin auf dem physischen Etikett stehen muss
Auch wenn die neue Regelung digitale Informationen stärker einbindet, müssen bestimmte zentrale Angaben weiterhin direkt auf der Verpackung von Reinigungsmitteln und Tensiden sichtbar sein. Dazu zählt:
- Produktidentifikation: Der vermarktete Produktname sowie eine Typen- oder Chargennummer (oder eine andere eindeutige Kennzeichnung) zur Rückverfolgbarkeit.
- Hersteller-/Verantwortlichendaten: Name, eingetragene Handelsmarke oder Marke und eine Postanschrift als zentrale Kontaktstelle des Herstellers oder der verantwortlichen Person für die Inverkehrbringung in der EU. Eine E-Mail-Adresse sollte ebenfalls angegeben sein.
- Sicherheits- und Anwendungshinweise: Wichtige Warnhinweise, Sofortmaßnahmen bei Unfällen (falls erforderlich) sowie alle verpflichtenden Angaben zum Schutz von Gesundheit und Umwelt. Diese Informationen müssen deutlich hervorgehoben und gut lesbar sein.
- Allergene und Konservierungsmittel:
- Ein klarer Hinweis auf allergene Duftstoffe, wenn sie über einer festgelegten Konzentrationsgrenze (z. B. 0,01 %) enthalten sind.
- Konservierungsmittel (wie Antioxidantien oder antimikrobielle Wirkstoffe), sofern im Produkt enthalten und relevant.
- Spezielle Anwendungshinweise: Bei Reinigungsmitteln für den Haushalt, z. B. Waschmittel oder Geschirrspültabs, bleiben standardisierte Dosieranleitungen auf dem Etikett verpflichtend – um Überdosierung zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.
- CE-Kennzeichnung: Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Etikett oder der Verpackung angebracht sein – als Nachweis für die Einhaltung der EU-Harmonisierungsvorgaben.
- Sprache: Alle verpflichtenden Angaben auf dem physischen Etikett müssen in der/den Amtssprache(n) des jeweiligen EU-Mitgliedstaats verfügbar sein, in dem das Produkt angeboten wird.
Dieses Konzept stellt sicher, dass die wichtigsten Informationen jederzeit zugänglich sind – auch ohne Smartphone oder Internetverbindung. Gleichzeitig entsteht Raum für weiterführende Details über digitale Kanäle.

Image: AISE (2023)
Die Abbildung zeigt ein typisches Etikett für Waschmittel mit zahlreichen Pflichtangaben zu Allergenen, Tensiden und Gefahren, ergänzt durch Online-Informationen. Markiert sind problematische Doppelungen, Widersprüche und schwer verständliche Fachbegriffe. Es wird deutlich, dass aktuelle Etiketten oft überladen und schwer nachvollziehbar sind. Besonders die uneinheitliche Darstellung von Allergenen und Inhaltsstoffen sorgt für Verwirrung.
Was digital bereitgestellt werden kann
Mit dem neuen Vorschlag entfällt künftig die Pflicht zur vollständigen Inhaltsstoffliste auf dem physischen Etikett in der Regel vollständig. Das ist ein bedeutender Schritt hin zu einfacheren Verpackungen und weniger Redundanz. Stattdessen muss die vollständige Liste der Inhaltsstoffe jetzt digital zugänglich gemacht werden, für nahezu alle Produkte.
- Inhaltsstoffliste: Die Bestandteile müssen in absteigender Reihenfolge nach Gewicht aufgeführt werden – unter Verwendung anerkannter Bezeichnungen wie INCI oder IUPAC – und jeweils mit Angabe ihrer Funktion (z. B. „anionisches Tensid“, „Enzym“).
- Detaillierte Informationen: Weitere Angaben wie umfassende Warnhinweise, Erste-Hilfe-Maßnahmen (sofern nicht bereits zwingend physisch anzugeben), Produktpass-Daten oder Hinweise zu Umwelt und Nachhaltigkeit können ebenfalls digital hinterlegt werden.
Technische Anforderungen für digitale Inhaltsstoffe und Etiketten
Die digitalen Inhalte, von der Inhaltsstoffliste bis zu weiteren Produktinformationen, müssen klaren technischen und barrierefreien Standards entsprechen:
- Zugänglichkeit und Verfügbarkeit:
- Rund um die Uhr frei zugänglich, ohne Registrierung, Downloads, die Angabe personenbezogener Daten oder die Zustimmung zu Cookies.
- Durchsuchbar, strukturiert und maschinenlesbar, für eine einfache Nutzung durch Verbraucher:innen und Fachleute.
- Mobiloptimiert, mit kurzer Ladezeit und ohne spezielle Software oder Geoblocking – in jedem EU-Mitgliedstaat, in dem das Produkt erhältlich ist.
- Informationen müssen klar, logisch und getrennt von Werbung oder anderen kommerziellen Inhalten dargestellt werden.
- Die Angaben müssen allen Nutzer:innen in der Union (einschließlich Behörden) offenstehen – und mindestens 10 Jahre lang ab dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens verfügbar bleiben, sofern keine andere EU-Gesetzgebung eine längere Frist verlangt.
- Der Zugriff darf nicht mehr als zwei Klicks erfordern.
- Digitale Etiketten müssen über gängige digitale Technologien aufrufbar sein – kompatibel mit allen wichtigen Betriebssystemen und Browsern, einschließlich mobiler Geräte.
- Sprache: Bereitstellung in der/den Amtssprache(n) des EU-Mitgliedstaats, in dem das Produkt vermarktet wird.
- Aktualisierungen: Änderungen an der Produktzusammensetzung müssen sofort digital aktualisiert werden.
- Datenschutz und Sicherheit: Die Nutzung digitaler Etiketten darf keine personenbezogenen Daten erfassen oder das Verhalten von Nutzer:innen nachverfolgen.
- Verlinkung zum DPP: Wo erforderlich, muss das digitale Etikett mit dem Digital Product Passport des Produkts verknüpft sein.
- Beständigkeit und Lesbarkeit des Datenträgers: Der Datenträger (z. B. QR-Code) muss sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Produkt, der Verpackung oder der Nachfüllstation angebracht sein. Eine kurze, verständliche Anleitung zur Nutzung digitaler Inhalte sollte direkt daneben stehen.
Digitale Tools wie beispielsweise info.link zeigen, wie sich solche Anforderungen in der Praxis umsetzen lassen. Sie ermöglichen es Hersteller:innen, umfassende Informationen zu Inhaltsstoffen, Funktionen und Sicherheitsdaten in einer strukturierten und benutzerfreundlichen Form bereitzustellen.
Über einen auf der Verpackung angebrachten QR-Code gelangen Verbraucher:innen direkt auf eine mobiloptimierte Seite, die alle erforderlichen Angaben enthält, transparent, kostenlos zugänglich und ganz ohne Registrierung. Solche Lösungen machen deutlich, dass die digitale Bereitstellung von Produktinformationen nicht nur eine regulatorische Pflicht ist, sondern auch einen echten Mehrwert für Nutzer:innen bietet.
Digitale Kennzeichnung: Bestimmte Anwendungsfälle und Anforderungen
Die neue Verordnung schafft mehr Flexibilität: bestimmte Informationen dürfen nun ausschließlich digital bereitgestellt werden.
Zulässige digitale Kennzeichnung, z. B. bei Nachfüllungen
Eine rein digitale Kennzeichnung ist ausdrücklich für Reinigungsmittel erlaubt, die Endverbraucher:innen im Nachfüllformat angeboten werden. Dieser Ansatz unterstützt die Reduzierung von Verpackungsmüll und stärkt Modelle der Kreislaufwirtschaft.
Auch bei Nachfülllösungen muss jedoch ein Mindestmaß an Informationen physisch bereitgestellt werden – entweder direkt an der Nachfüllstation oder auf dem wiederverwendbaren Behälter. Für alle nachgefüllten Reinigungsmittel gilt:
- Identifikation der Substanz oder Mischung (z. B. Produktname)
- Name oder eingetragener Handelsname/Markenzeichen des Herstellers oder der verantwortlichen Person für die Bereitstellung auf dem EU-Markt
- Postanschrift (ein zentraler Kontaktpunkt) sowie E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme
- Allergenkennzeichnung (sofern relevant und über dem Schwellenwert)
Bei Waschmitteln für Verbraucher:innen müssen die standardisierten Dosieranweisungen auch im Nachfüllkontext immer physisch auf dem Etikett bleiben.
Sprachen, Formatierung und Barrierefreiheit: Informationen für alle zugänglich machen
Die neue Verordnung legt großen Wert darauf, dass Produktinformationen – ob physisch oder digital – für alle Nutzer:innen in der EU klar und zugänglich sind.
Sprachvorgaben
Sämtliche Pflichtinformationen – von Produktname über Sicherheitshinweise bis zu Allergenangaben und Herstellerkontakt – müssen in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen des EU-Mitgliedstaats bereitgestellt werden, in dem das Produkt Endverbraucher:innen zur Verfügung gestellt wird. Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Systeme Inhalte in mehreren Sprachen verwalten und ausspielen können – abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Zielmarkts.
Formatierungsstandards
- Physische Etiketten: Alle Informationen müssen sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Sicherheits- und Gebrauchshinweise müssen klar hervorgehoben sein – ohne Ablenkung durch Marken- oder Designelemente. Zwar ist keine Mindestschriftgröße vorgeschrieben, aber gute Lesbarkeit hat oberste Priorität.
- Digitale Etiketten: Digitale Inhalte müssen sofort, direkt und ohne Umwege abrufbar sein – nicht versteckt hinter mehreren Klicks oder vermischt mit Werbung. Die Darstellung sollte logisch strukturiert, benutzerfreundlich und im Idealfall visuell an die physische Etikettierung angelehnt sein.

Barrierefrei zugänglich gestalten
Ein zentrales neues Element ist die klare Anforderung, dass Informationen für alle Nutzer:innen verständlich und barrierefrei zugänglich sein müssen – auch für Menschen mit Behinderungen. Zwar nennt die Verordnung keine konkreten technischen Vorgaben wie im EU Accessibility Act, dennoch wird deutlich erwartet, dass digitale Informationsportale (z. B. über QR-Codes) aktuellen Best Practices für Web-Barrierefreiheit folgen. Dazu gehören unter anderem:
- Kompatibilität mit Screenreadern
- Skalierbare Schriftgrößen
- Klare, nachvollziehbare Navigation
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund
Auch physische Etiketten sollen zur Barrierefreiheit beitragen – etwa durch den Verzicht auf schwer lesbare Farbkombinationen oder zu kleine Schrift. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Sicherheits- und Gebrauchsinformationen für alle zugänglich sind – ein wichtiger Schritt für mehr Verbraucherschutz.
Digitale Kennzeichnung umsetzen und compliant bleiben
Der Umstieg auf digitale Etiketten erfordert eine systematische Vorgehensweise – neue Technologien und Abläufe werden in bestehende Prozesse integriert. So gelingt die praktische Umsetzung:
1. Zugangsmethode für die digitale Kennzeichnung wählen
Das passende Trägermedium auswählen, das am besten zum Produkt und der Lieferkette passt. Übliche Optionen sind:
- QR-Codes: Weit verbreitet und einfach per Smartphone scannbar. Optimalerweise folgen QR-Codes dem neuen globalen GS1 Digital Link Standard, der ab 2027 Barcodes ablöst. Mehr dazu im umfassenden GS1 Digital Link Guide. QR-Codes sollten zusätzlich Hyperlinks enthalten (siehe unten), falls das Scannen nicht klappt.
- Hyperlinks: Kurze, gut einzugebende URLs, die unter dem QR-Code gedruckt werden und als Alternative zum Scannen dienen.
- NFC-Tags: Bieten Tap-and-Go-Komfort, benötigen aber NFC-fähige Geräte. Technische Hürden und Erklärungsbedarf machen diese Option weniger attraktiv.
Die gewählte Methode muss gut sichtbar, lesbar und dauerhaft auf dem Produkt, der Verpackung oder – bei Nachfüllformaten – an der Nachfüllstation angebracht sein. Endverbraucher:innen müssen den Zugang vor dem Kauf klar erkennen können.
2. Robuste Plattform für die digitale Kennzeichnung aufbauen
Das digitale Label und der Digital Product Passport brauchen ein zentrales Portal, das:
- Mobilfreundlich ist und schnell lädt
- Sofort, kostenlos und rund um die Uhr ohne Registrierung, Download oder Zustimmung zu Cookies/Datenschutz verfügbar ist
- Die erforderlichen EU-Sprachen unterstützt
- Informationen klar und übersichtlich darstellt, getrennt von Marketinginhalten
- Gut strukturiert ist, damit Nutzer:innen schnell die gewünschten Details finden
- Web-Barrierefreiheitsstandards erfüllt (Screenreader, skalierbarer Text, hoher Kontrast) und so alle Nutzer:innen anspricht
Das Bild zeigt ein Beispiel für eine robuste Plattform, welche Compliance gewährleist: Mit info.link lassen sich rechtskonforme Digital Labels erstellen, verknüpft mit zukunftssicheren QR-Codes.
QR Code scannen um das Waschmittel-Beispiel interaktiv zu sehen! Oder Short Link verwenden: info.link/jq720

3. Datenmanagementsysteme integrieren
Um jederzeit korrekte Informationen zu gewährleisten, muss das digitale Label-System nahtlos mit internen Datenmanagementsystemen wie ERP (Enterprise Resource Planning) oder PLM (Product Lifecycle Management)verbunden sein. Änderungen an Produktzusammensetzung, Sicherheitsdaten oder Compliance müssen sofort digital sichtbar werden. Jeder digitale Code/Label bezieht sich auf ein spezifisches Modell (Produktart), da sich die Verordnung im Juni 2025 zugunsten eines praktikableren Modell-basierten Ansatzes von der batch-bezogenen DPP-Pflicht verabschiedet hat.
4. Datenschutz und Sicherheit gewährleisten
Das Tracking, Analysieren oder die Nutzung von Daten zur Verwendung der digitalen Kennzeichnung ist streng verboten, außer zur reinen Bereitstellung der Informationen. Hersteller müssen robuste Datenschutzmaßnahmen umsetzen, um die Vorgaben der GDPR einzuhalten und unbefugte Datenerfassung zu verhindern.
5. Alternative Zugangswege anbieten
Um digitale Barrieren oder technische Ausfälle auszugleichen, müssen Hersteller Informationen der digitalen Kennzeichnung auf mündliche oder schriftliche Anfrage kostenlos und unabhängig vom Kauf auch auf anderen Wegen bereitstellen, falls das digitale Label vorübergehend nicht verfügbar ist.
Mit diesem systematischen Vorgehen erfüllen Hersteller die neuen Anforderungen zur digitalen Kennzeichnung – und profitieren gleichzeitig von mehr Transparenz und Effizienz.
Fit machen: Ressourcen, Systeme und Teamkoordination
Um die Anforderungen der neuen EU Detergent Regulation bis zum Stichtag voll zu erfüllen, braucht es einen umfassenden Strategieplan – von Personal und IT-Infrastruktur bis hin zu rechtlicher Prüfung und internen Abläufen.
Checkliste IT-Infrastruktur
- Digitale Label-Plattform: Tools zum Erstellen und Verwalten von
- einzigartigen QR-Codes oder anderen Daten-Trägern für jedes Produkt bzw. jede Charge
- robusten, mobiloptimierten digitalen Labels mit Inhaltsstoffen, Sicherheitsinfos und Digital Product Passports für Verbraucher:innen, Behörden und Handelspartner
- Systemintegration: Nahtlose Anbindung der digitalen Label-Plattform an bestehende ERP (Enterprise Resource Planning) und PLM Systeme (Product Lifecycle Management), um Produktdaten, Rezepturen und Chargeninformationen in Echtzeit zu synchronisieren
- Datensicherung und Sicherheit: Leistungsfähige Lösungen für Echtzeit-Updates, sichere Archivierung (mindestens 10 Jahre) und volle GDPR Konformität
Rechtliche & regulatorische Prüfung
- Gap-Analyse: Detaillierte Prüfung mit Jurist:innen oder externen Berater:innen, um Unterschiede zwischen aktuellen Prozessen und neuen Anforderungen zu erkennen
- Kontinuierliche Überwachung: Einrichtung eines Prozesses zur laufenden Beobachtung von Updates, Klarstellungen und Leitlinien der EU- und Mitgliedstaatenbehörden
- Dokumentationspflicht: Planung zur sicheren Aufbewahrung aller technischen und Compliance-Dokumente für mindestens 10 Jahre
Prozesse und Schulungen
- SOP-Anpassungen: Überarbeitung der Standard Operating Procedures (SOPs) für Produktkennzeichnung, IT-Management, Rückverfolgbarkeit, Korrekturmaßnahmen und Kommunikation mit Marktüberwachungsbehörden
- Mitarbeiterschulungen: Umfassende Trainings zu neuen Compliance-Anforderungen, digitaler Kennzeichnung, Meldeverfahren und Umgang mit Verbraucherfragen zu digitalen Tools
- Interne Audits: Simulation von behördlichen Prüfungen zur Überprüfung der Zugänglichkeit und Richtigkeit von physischen und digitalen Daten
Externe Unterstützung
Für Unternehmen, die keine eigene Plattform entwickeln möchten, bieten sich externe Lösungen wie info.link an. Solche Plattformen sind speziell für die Anforderungen der EU-Regularien konzipiert und ermöglichen eine einfache und schnelle Bereitstellung aller notwendigen Produktinformationen in digitaler Form. Nutzer erhalten sofortigen Zugriff auf eine klar strukturierte, werbefreie und in mehreren EU-Sprachen verfügbare Darstellung, optimiert für Mobilgeräte und kompatibel mit allen gängigen Browsern und Betriebssystemen.

Intelligente Marktüberwachung, einfachere Compliance
Digitale Kennzeichnung ermöglicht Behörden einen Echtzeit- und standardisierten Zugriff auf Compliance-Daten.
Zentrale Vorteile für Industrie und Behörden
Für Unternehmen:
- Effizientere Compliance-Prozesse
- Weniger administrativer Aufwand
- Mehr Fokus auf Innovation
Für Behörden:
- Schnellere, einheitliche Durchsetzung
- Verbesserter Verbraucherschutz
- Ressourcenfokus auf risikoreiche Bereiche
Digitalisierung als Treiber nachhaltiger Transformation
Die Einführung von DPPs und digitalen Labels zwingt Unternehmen, IT-Systeme zu modernisieren, Produktinformationen zu zentralisieren und Echtzeit-Updates zu ermöglichen. Diese Modernisierung automatisiert Compliance nicht nur, sondern steigert auch die operative Effizienz, senkt Kosten und eröffnet neue Möglichkeiten für eine intensivere Kundenbindung, etwa durch detaillierte Produktinfos und mehr Transparenz.
Wichtig: Die Digitalisierung passt perfekt zu den Umweltzielen der EU. Digitale Produktinformationen unterstützen die Kreislaufwirtschaft, z. B. Nachfüllsysteme und Mehrwegverpackungen, indem physische Labels überflüssig werden. Außerdem ermöglichen sie ein robustes Tracking von Nachhaltigkeitsdaten entlang der Lieferkette, fördern ESG-Reporting und stärken das Vertrauen der Verbraucher:innen durch transparente Angaben zu Inhaltsstoffen und Umweltauswirkungen.
Wie Digitalisierung Nachhaltigkeit stärkt:
- Fördert Kreislaufwirtschaft (z. B. Nachfüllungen, Mehrwegverpackungen)
- Ermöglicht transparente Kommunikation von Umwelt- und Inhaltsstoffdaten
- Unterstützt stärkeres ESG-Reporting und Lieferkettentransparenz
- Befähigt Verbraucher:innen zu bewussten, nachhaltigen Kaufentscheidungen
Strategischer Vorsprung im Wandel
Eine frühzeitige und umfassende Umsetzung dieser Anforderungen sichert nicht nur Compliance, sondern positioniert Unternehmen als innovativ, transparent und verantwortungsvoll.
Digitale Compliance jetzt umsetzen heißt:
- Echtzeit-Updates minimieren Rückruf- und Regulierungsrisike
- Markenimage als innovativ und vertrauenswürdig stärken
- Zugang zu EU-Förderungen und erleichtertem Markteintritt durch Ausrichtung an Green Deal und Digital Single Market
Die EU Detergents Regulation zeigt, wie stark sich regulatorische Anforderungen an Produktinformationen verändern und wie wichtig es ist, von Anfang an auf digitale Lösungen zu setzen, die nicht nur aktuelle Pflichten erfüllen, sondern auch künftige Entwicklungen mitdenken.
info.link ermöglicht eine zentrale Verwaltung aller gesetzlich geforderten Angaben und lässt sich bei Änderungen der Rechtslage oder Produktzusammensetzung unkompliziert anpassen, ganz ohne technische Komplexität oder Brüche im Informationsfluss. Ob neue Anforderungen zur Barrierefreiheit, sprachspezifische Ausspielung oder Verlinkung mit dem Digital Product Passport: Eine flexible Plattformstruktur sichert langfristige Compliance und reduziert operativen Aufwand. Darüber hinaus kann Nutzer:innen über die zahlreichen weiteren Integrationen echter Mehrwert geboten werden.
FAQHäufig gestellte Fragen
Autor
Max Ackermann
Max Ackermann ist Gründer & CEO von info.link, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Hamburg und Berlin. info.link hilft Brands, Produkte in smarte, compliance-konforme digitale Touchpoints zu verwandeln. Max bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Businesses mit und leitete bei McKinsey die Design- und Corporate Venture Teams in Europa. Außerdem hat er digitale Produkte und Plattformen für globale Marken wie Nike, Google, Meta und Airbnb entwickelt. Max unterstützt Brands dabei, GS1-standardisierte Digital Labels zu erstellen, um Green Claims, Digital Product Passports, Produktinformationen, Promotions und mehr zu teilen. Er ist Experte für QR Codes, Green Claims, EU-Regulatorik, multilingual Digital Labeling und ist Fellow der Higher Education Academy in Großbritannien.